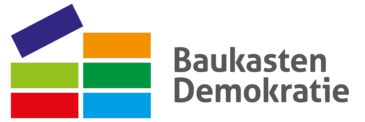Die Junge Theaterakademie hat in Offenburg mit der Aufführung von „Wir sind ganz junge Bäumchen“ zur Deportation nach Gurs vor 85 Jahren tief bewegt – und sogar zu Tränen gerührt.
von Juliana Eiland-Jung, Badische Zeitung vom 27. Oktober 2025
Fotos: Armin Krüger
Nach der Aufführung von „Wir sind ganz junge Bäumchen“ am Freitagabend im Salmen in Offenburg wischten sich einige der 200 Zuschauer die Tränen aus den Augen. Der Jungen Theaterakademie ist es gelungen, die Geschichte der Deportation der Juden aus Baden, dem Saarland und der Pfalz vor 85 Jahren ins Internierungslager Gurs in Südfrankreich anrührend nachzuerzählen.
Nanette Wolf, Großnichte von Clémentine Neu, die am 22. Oktober 1940 zusammen mit ihrem Mann Emil aus Offenburg nach Gurs deportiert wurde und den Holocaust überlebte, sprach vielen der Anwesenden aus der Seele: „Das war eines der beeindruckendsten Theaterstücke, das ich je gesehen habe. Ältere, erfahrenere Schauspieler hätten das nicht leisten können, was ihr geschafft habt. Das werde ich in meinem Herzen mitnehmen. Danke. Danke. Danke.“ Schon zum Auftakt der von Michael-Cornelius Hermann, Leiter der Stabsstelle für Religionsangelegenheiten im baden-württembergischen Kultusministerium, geleiteten Gesprächsrunde im Anschluss an die Theateraufführung hatte Wolf gesagt: „Ich bin begeistert von euch allen. Der Ausdruck, den ihr gebracht habt, hat mich im positiven Sinn total fertig gemacht“.

Podiumsgespräch, von links nach rechts: Prof. Dr. Michael-Cornelius Hermann, Nanette Wolf, Staatssekretär Volker Schebesta, Natalia Brandauer (Saint-Germain-en-Laye), Agnes Büchner (Lebach)
Zeitgemäße Erinnerungsarbeit?
Hermann fragte Staatssekretär Volker Schebesta, der wie auch die Offenburger Kulturchefin Carmen Lötsch ein Grußwort gesprochen hatte, ob solche Theaterprojekte, bei denen sich die Beteiligten intensiv mit den Lebensgeschichten der Holocaust-Opfer befassen, eine neue Form der „zeitgemäßen Erinnerungsarbeit“ sein könnten. Da es nur noch wenige lebende Zeitzeugen gebe, sei dies „die authentischste und adäquateste Art der Erinnerung“, bekräftigte Schebesta.
Tatsächlich ist es der Jungen Theaterakademie unter Leitung von Paul Barone gelungen, dieses Projekt, das Jugendliche aus der Region Paris, dem pfälzischen Hermeskeil, dem saarländischen Lebach und Offenburg zusammenbrachte, zu einem Leuchtturm der Erinnerungs- und Theaterarbeit zu machen. Die am Podiumsgespräch beteiligten Jugendlichen hatten sich über Monate intensiv auf die bislang geplanten drei Aufführungen vorbereitet.
Starke Bilder, die das Publikum bewegen
Gestalterisch bleibt die Theaterakademie sich treu mit ihrem Fokus auf starke Bilder, die oft als Tableaus stehenbleiben, aus denen heraus sich kleine Szenen entwickeln. Ohne Bühnendekoration, nur mit wenigen Requisiten und Kostümen, liegt die ganze Aufmerksamkeit auf dem Gesamtbild der Szene, den Gesichtern der Schauspielerinnen und Schauspieler und den jeweils nur kurzen Interaktionen. Der aus deutschen und französischen Passagen zum Teil chorisch, zum Teil als Kommentar aus dem Off gesprochene Text ist so verkürzt und konzentriert, dass jedes einzelne Wort, jede Betonung, jeder Blick und jede Geste wichtig werden. Dazu kommt der vom Offenburger Komponisten Leonard Küßner geschaffene Soundtrack, der die atmosphärische Dichte des Stückes sehr eindrucksvoll stützt.
Die Jugendlichen zeigen nicht nur die bedrückende Wirklichkeit im Lager, sondern auch den Lebensmut der Internierten, die sich gegenseitig helfen, die singen, Musik machen und Theater spielen – trotz alledem. Das in Gurs von Alfred Cahn komponierte und von Leopold Rauch getextete Lied „Wir sind ganz junge Bäumchen“, das in eindringlich-einfacher Sprache die Entwurzelung der Internierten thematisiert, wird zum Sinnbild des Widerstands und der Trauer zugleich.
Körperliche Brutalität spart die Inszenierung weitgehend aus
Schikane und Überlebenskampf, Sterben und Geburt, Hochzeitsantrag und Abtransport ins Vernichtungslager liegen nah beieinander. Körperliche Brutalität spart die Inszenierung weitgehend aus, ohne deshalb weniger bedrückend zu wirken. Auch dies ist eine von den Jugendlichen reflektierte Facette des Ganzen, denn Ziel sei es gewesen, die Aufseher nicht als Monster erscheinen zu lassen, erklärt die 17-jährige Nathalie aus Frankreich. Bei ihrer Recherche hätten sie festgestellt, dass die Täter „ganz normale, gebildete Menschen“ gewesen seien. Genau wie die Nachbarn, die bei Versteigerungen billig an den Hausrat ihrer früheren jüdischen Mitbürger kamen, aber auch die Rot-Kreuz-Mitarbeiterinnen, die viele Kinder aus Gurs herausholen konnten.
Viele Schicksale der deportierten Juden sind inzwischen gut dokumentiert. Das Theaterstück zeigt, dass Nacherzählung der Fakten nur ein Teil der Aufarbeitungs- und Erinnerungsarbeit sein kann. Das Publikum applaudierte minutenlang stehend, ergriffen und begeistert zugleich. Ein beeindruckendes, bewegendes Theaterereignis, das der Jungen Theaterakademie und der Geschichte des Salmen zur Ehre gereicht.

Menschlichkeit inmitten des Grauens
Im Salmen – einst Synagoge und heute Gedenkort – hat die Junge
Theaterakademie am Freitagabend ihr Stück „Wir sind ganz junge
Bäumchen“ präsentiert. Das deutsch-französische
Jugendtheaterprojekt erinnert zum 85. Gedenktag an die Deportation
der jüdischen Bevölkerung nach Gurs.
von Natali Bergen, Offenburger Tageblatt vom 27. Oktober 2025
Offenburg. „Im Morgengrauen des 22. Oktober 1940 wurden zahlreiche jüdische
Mitbürger in Offenburg aus dem Schlaf gerissen, zum Bahnhof getrieben und mit
Zügen Richtung Gurs deportiert.“ Mit diesen Worten eröffnete Kulturchefin Carmen
Lötsch die Inszenierung „Wir sind ganz junge Bäumchen“ der Jungen
Theaterakademie im Salmen. Über der Frage nach den Tätern liege bis heute „ein
bleierner Mantel des Schweigens“. Sie dankte Paul Barone für die große Aufgabe,
dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte in einem Theaterprojekt aufzuarbeiten.
„Wir Nachgeborenen tragen die niemals endende Verantwortung, dass so etwas nie
wieder geschieht.“
Die Grußworte Volker Schebestas, CDU-Staatssekretär im Kultusministerium, hieben
in dieselbe Kerbe: „Ein Theaterstück wie dieses setzt ein wertvolles Zeichen gegen
das Vergessen.“ Kaum waren seine letzten Worte verklungen, zerfetzten Stiefeltritte
und militärische Kommandos einmarschierender Wachleute die Stille im Publikum:
„Ihr habt eine Stunde zum Packen.“
Koffer und Habseligkeiten säumten die Bühne wie stumme Zeugen. In den
Gesichtern der Schauspieler spiegelte sich das Grauen jener Nacht – ein Bild der
erzwungenen Bewegung, des Abschieds ohne Wiederkehr. Der Schrecken der
authentischen Charaktere, die sich die Schüler selbst ausgesucht hatten, wurde
plastisch dargestellt: leere, starre Blicke, fahrige Hände, Angst, Beklemmung. Die
zusammengepferchte Zugfahrt ins Lager, die Gräuel nach der Ankunft vor Ort: Kälte,
Regen, Dunkelheit, Erschöpfung, Krankheit.
Wie Kunst half
Doch inmitten des Dunkels öffneten sich kleine Räume der Menschlichkeit – Szenen,
in denen Kunst half, das Unfassbare zu ertragen. Im Lager entstanden kleine
Theateraufführungen, Lieder, Zeichnungen. Einer dieser Funken war der Kinderchor
von Gurs. Dort, mitten im Elend, schrieb Leopold Rauch 1941 das Lied „Wir sind
ganz junge Bäumchen aus fernem Heimatland“, vertont von Alfred Cahn. Die jungen
Darsteller griffen dieses Lied in ihrer Inszenierung wieder auf: ein Lied, das aus der
Stille kam und Menschlichkeit zurückbrachte.
Die vorwiegend in Molltönen gehaltene Musik von Leonard Küßner durchzog das
Stück – ein Klangteppich aus Trauer und Hoffnung, der sich über ein
minimalistisches Bühnenbild legte: Leere als Ausdrucksmittel.
Die jungen Akteure hatten für das schul- und grenzübergreifende Projekt in
monatelanger Vorbereitung Biografien aus ihren Heimatregionen recherchiert
Menschen, die 1940 nach Gurs deportiert worden waren. Jeder wählte eine Person
und einen Gegenstand, der ihre Geschichte symbolisierte: ein Buch, ein Tuch, ein
Schlüssel, eine Geige. In Improvisationen entstanden daraus Szenen, Texte und
innere Monologe. So erzählte das Stück nicht nur Geschichte, sondern gab jenen
Namen und Gesicht, die sonst in Akten verzeichnet geblieben wären. Das Publikum
würdigte die jungen Darsteller mit minutenlangen Standing Ovations.
Im Anschluss fand eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Bernhard
Herrmann, Leiter der Stabsstelle für Religionsangelegenheiten und
Staatskirchenrecht im Kultusministerium, statt. Auf dem Podium saßen neben
Volker Schebesta Nanette Wolf, Großnichte der Lagerinsassin Clementine Neu,
einige der Jugendlichen sowie die französische Musikwissenschaftlerin Mélina
Burlaud, die über die im Lager Gurs entstandene Musik promoviert hat.
Tief berührend
Nanette Wolf zeigte sich tief berührt: „Ältere Schauspieler hätten das so nicht leisten
können. Es war eines der berührendsten Stücke, die ich zu diesem Thema gesehen
habe.“ Volker Schebesta fand mahnende Worte angesichts des wieder
zunehmenden Antisemitismus und wünschte sich, dass solche Aufführungen dazu
beitragen, „die Selbstverständlichkeit zurückzugewinnen, mit der jüdische Mitbürger
Teil unserer Gesellschaft sind“.
Lina und Neele Brittner, die im Stück die Schwestern Margot und Hannelore
Schwarzschild verkörperten, lobten die Gruppendynamik, die trotz der „Schwere
des Stückes“ im Rekordtempo entstanden war. Natalia Brandauer, die eine
Wachsoldatin spielte, fand es „sehr schwer, in diese Figur hineinzufinden. Man will
nichts verharmlosen, aber man darf sie auch nicht als Monster spielen. Es waren
Menschen – Menschen, die Schreckliches taten.“ Agnes Büchner berichtete über die
große Unterstützung, aber auch die Besorgnis seitens ihrer Familie, ein so sensibles
Thema auf die Bühne zu bringen. „Es war emotional sehr fordernd, aber ich bin
stolz, Teil davon zu sein.“
Für Paul Barone ist das Projekt damit keineswegs abgeschlossen. Er wünscht sich,
einzelne Biografien – etwa die der Familie Neu – weiter zu vertiefen. „Theater ist
Erinnerung in Bewegung“, sagt er. „Es kann Geschichte nicht ungeschehen machen,
aber es kann sie zum Klingen bringen. Gerne mehr davon!“
Mit einem „Hals- und Beinbruch“ entließ Moderator Herrmann die Theatergruppe
auf den Weg nach Paris, wo das Stück am folgenden Tag erneut aufgeführt werden
sollte – und ließ ein sichtlich nachdenklich-bewegtes Publikum zurück.